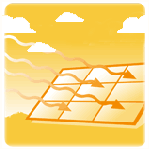22. Juli 2010
Die Steinkohle-Bergwerke in Deutschland sollten ursprünglich bis zum Jahr 2018 in Betrieb bleiben. Doch nun wurde der EU-Kommission vom EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia ein Vorschlag vorgestellt, in dem die Schließung von unwirtschaftlichen Bergwerken bereits zum 15. Oktober 2014 erfolgen soll. Entschieden ist bislang noch nichts, denn der Vorschlag muss erst vom EU-Ministerrat geprüft werden.
Vorzeitige Schließungen und Massenentlassungen verhindern
Am 15. Oktober 2014 ist Stichtag, denn dann laufen die Fördermaßnahmen für Steinkohle aus. Daher rührt auch der Entschluss, unwirtschaftliche bis zu diesem Termin zu schließen. Im vergangenen Jahr sollen etwa 2 Milliarden Fördermittel aus Steuergeldern in die Steinkohle geflossen sein. Von den sechs deutschen Bergwerken sollen drei mindestens bis 2012 oder gar bis 2018 weiter genutzt werden. Der Schließungstermin für die anderen drei stünde bereits fest. Laut RAG Deutsche Braunkohle AG waren insgesamt 27.000 Menschen in den Bergwerken beschäftigt. „Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung alles tut, damit das deutsche Ausstiegsszenario mit der Frist bis 2018 umgesetzt wird“, sagte ein Sprecher der RAG.
Michael Vassiliadis (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) erklärte, „Wir werden uns mit allen Mitteln gegen ein Auslaufen der deutschen Steinkohleförderung bis Oktober 2014 zur Wehr setzen. Denn das würde Massenentlassungen zur Folge haben. Jetzt muss die Bundesregierung ran. Sie muss dafür sorgen, dass der 2007 vereinbarte Kohlekompromiss und das Steinkohlefinanzierungsgesetz umgesetzt werden können“.
Subventionen sollen jährlich gekürzt werden
EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia erklärte, „Unternehmen müssen ohne staatliche Hilfe überleben können“ und fügte hinzu „gemessen an der Nachfrage gering und außerdem rückläufig“. Im vorliegenden Bericht ist weiterhin vorgesehen, die Subventionen bis Oktober 2014 jährlich zu kürzen. Werden die Bergwerke nach dem 15.Oktober 2014 weiter betrieben, sollen die gezahlten Fördermittel zurückgezahlt werden.
Bis zum Jahresende muss der EU-Ministerrat eine Entscheidung zum vorgelegte Kommissionsvorschlag getroffen haben, denn dann laufen die bisher getroffenen Regelungen aus. Im Ministerrat sind alle 27 Mitgliedstaaten der EU vertreten und entscheiden gemeinsam über das weitere Vorgehen.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
21. Juli 2010
„DanTysk“, so heisst der neue Windpark vor der Küste der Nordseeinsel Sylt. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall und die Stadtwerke München (SWM) haben bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der sie sowohl Planung und Bau des Offshore-Windparks regeln. Dazu wird ein Gemeinschaftunternehmen gegründet, an dem Vattenfall 51 Prozent und die Stadtwerke München 49 Prozent hält.
Wege für Offshore-Windparks ebnen
Der Vorstandsvorsitzende von Vattenfall Europe, Tuomo Hatakka sagte, „Wir wollen aber auch unser Engagement in Deutschland fortsetzen, DanTysk soll dafür nach dem fertig gestellten Testfeld alpha ventus der nächste wichtige Meilenstein für Vattenfall sein. Erforderlich ist allerdings, dass die Politik die junge Offshore-Branche weiterhin unterstützt. Die Risiken beim schnellen Einstieg in die Stromerzeugung auf See müssen gemeinsam bewältigt werden“.
Auch die Stadtwerke München planen weitere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Unter anderem sei ein weiterer Offshore-Windpark vor der walisischen Küste mit 160 Windkraftanlagen und einem Investitionsvolumen von 2 Mrd. Euro geplant. Umgesetzt werde dieses Projekt gemeinsam mit Siemens und RWE-Innogy.
Investitionssumme für „DanTysk“ steht noch nicht fest
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Planungsarbeiten zum Bau und Betrieb des Windparks weit fortgeschritten. Die Verhandlungen mit Herstellern und Zulieferern werden bis zum Herbst abgeschlossen sein. Auch die Entscheidungen bzgl. der Investitionssumme müssen bis zum Herbst fallen. Ob der finanziell gesteckte Rahmen eingehalten werden kann, ist bislang noch unklar.
In gut 30 Metern Tiefe sollen auf einer Fläche von 70 Quadratmetern 80 Windkraftanlagen errichtet und ans Netz gebracht werden. Entsprechend dem Bauplan sollen die ersten Windkraftanlagen bereits 2013 in Betrieb genommen werden. Mindestens 500.000 Haushalte sollen mit der erzeugten Windenergie versorgt werden.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
20. Juli 2010
Die USA galten seit über 100 Jahren als Spitzenreiter beim Energieverbrauch, doch nun nimmt China diesen Platz ein. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) mitteilte, verbrauchte China vergangenes Jahr 2252 Millionen Tonnen Öläquivalent. Die chinesische Zentralregierung wird durch die Entwicklung des Stromverbrauchs vor große Herausforderungen gestellt. Einerseits muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung sicher und stabil ist. Andererseits sind die globalen Klimaschutzziele in Gefahr.
Infrastruktur für Stromversorgung ausbauen
Nach Angaben der IEA wären in den nächsten 20 Jahren Investitionen in Höhe von 4.000 Milliarden Dollar notwendig, um die chinesische Energieversorgung zu stabilisieren. Dies hat die Zentralregierung in Peking vor Jahren schon erkannt und ist bemüht die Infrastruktur der Energieversorgung auszubauen. Auch der Produktionsbereich ist vom rasant steigenden Strombedarf betroffen und energieintensive Produkte werden nicht mehr selbst hergestellt sondern importiert. Dies kommt den Industrieunternehmen anderer Länder zugute. , „Da China mit seiner Energie haushalten muss, werden die Chinesen auch künftig energieintensive Produkte wie Aluminium importieren müssen. China weiß, dass der Bedarf an Energie weiter rasant steigen wird. Die Regierung hat daher eine Exportsteuer auf Produkte wie Aluminium erlassen.“, erklärte Klaus Kleinfeld (Alcoa, US-Aluminiumkonzern).
Globale Klimaschutzziele in Gefahr
Sowohl in China als auch in anderen Schwellenländern steigt der Energieverbrauch überdurchschnittlich an. Das führt in der Folge zur enormen Steigerung des CO2-Ausstoßes. Viele Länder bemühen sich erfolgreich um die Verringerung der CO2-Emission doch deren Erfolge werden durch die erhöhte CO2-Emission der Schwellenländer und China wieder aufgehoben. Obwohl China große Summen in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in den Bau von Atomkraftwerke investiert hat, werden noch immer 70 Prozent des Energiebedarfs durch Kohle gedeckt.
Auch wenn sich China nicht an den internationalen Emissionszielen beteiligt, verfolgt das Land eigene Ziele zum Klimaschutz. Neben dem Bau von 23 neuen Atomkraftwerken soll auch die Energieeffizienz des Landes verbessert werden und auch die Energiegesetze des Landes gelten als fortschrittlich.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
19. Juli 2010
Neben der geplanten Brennelemente-Steuer soll nun noch eine weitere Abgabe für die Betreiber von Atomkraftwerken eingeführt werden. Diese ist in Verbindung mit der Laufzeitverlängerung der Kraftwerke zu entrichten. Rainer Brüderle (Bundeswirtschaftsminister, FDP) erklärte, „Wir sollten mindestens 50 Prozent der Gewinne abschöpfen, die bei längeren Laufzeiten von Atomkraftwerken anfallen“. Diese Abgabe soll in den Ausbau der erneuerbaren Energie investiert werden, wohingegen die Brennelemente-Steuer zur Sanierung des Haushaltes genutzt werden soll.
Laufzeitverlängerung noch immer nicht entschieden
Ursprünglich wurden im Jahr 2001 zwischen der Atomwirtschaft und der Bundesregierung Vereinbarungen zum Atomausstieg getroffen. Die Laufzeit der Atomkraftwerke wurde im Schnitt auf 32 Jahre festgelegt. Die neue Bundesregierung plant nun die Verlängerung der Laufzeiten, um die Atomenergie als Brückentechnologie zu nutzen, bis die erneuerbaren Energien den Energiebedarf sicher abdecken können. Es sind Laufzeiten zwischen acht und 15 Jahren im Gespräch.
Neue Abgabe könnte Rentabilität gefährden
Sowohl ie Betreiber der Atomkraftwerke als auch einige Politiker halten weitere Gewinnabschöpfungen für unberechtigt. Den Energiekonzernen zufolge hatten diese mit einer Abgabe von etwa 1,5 Cent je Kilowattstunde gerechnet. Die Brennelemente-Steuer würde jedoch den Strompreis bereits um das Doppelte belasten. Die Konzerne befürchten, dass die Laufzeitverlängerung durch die geplanten finanziellen Belastungen unrentabel werden könnte.
Auch Horst Seehofer (Ministerpräsident Bayerns, CDU) sprach sich gegen eine zusätzliche Abgabe aus. Er sagte, „Wir sollten nicht jede Woche eine neue Olympiade über zusätzliche oder neue Abgaben veranstalten“.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
16. Juli 2010
Bereits seit dem vergangenen Jahr ist die Abtrennung und Lagerung von klimaschädlichem CO2 im Gespräch. Doch durch Proteste kam es bisher nicht zu Einigungen oder gar zu einem Gesetz. Nun scheint sich ein gemeinsamer Weg abzuzeichnen. Mit der Entwicklung der CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) hat Deutschland auf diesem Gebiet eine Führungsrolle eingenommen, die es nun durch die praktische Erprobung zu festigen gilt. Ob diese neue Technologie ab 2017 zum kommerziellen Einsatz kommt, ist laut Norbert Röttgen (Umweltminister) nicht klar.
Sicherheit geht vor
Wie auch bei der Lagerung von Atomabfällen sehen die Bürger die Lagerung von klimaschädlichem CO2 sehr kritisch. Um ihnen die Sorgen zu nehmen, erklärte Röttgen, „Wir haben mit diesem Gesetzentwurf den rechtlich und technisch maximalen Sicherheitsstandard festgeschrieben. Mehr geht nicht“. Durch die Erprobungsphase soll die Akzeptanz in der Bevölkerung gestärkt werden. Auch die Umweltorganisation Greenpeace warnt vor den Risiken. Beispielsweise könnten durch ein Leck große Mengen an CO2 frei werden und den Anwohnern zum Erstickungstod führen.
Für den Betrieb von CO2-Lagern sei die Zustimmung der jeweiligen Kommune notwendig, man werde nicht über den Kopf der Bundesländer hinweg entscheiden, so Röttgen. Für die Bundesländer, die sich für den Betrieb von CO2-Lagern entscheiden, werde es Ausgleichszahlungen geben.
Voraussetzung für ein solches CO2-Lager ist die geologische Eignung, die langfristig die Sicherheit gewährleisten muss. Jährlich sollen nicht mehr als 3 Millionen Tonnen CO2 pro Anlage unter der Erde gespeichert werden. Zwei bis drei kleine bis mittlere Testanlagen sind vorerst in Planung.
Erstes Lager in Beeskow?
Ein Standort für das erste CO2-Lager könnte die brandenburgische Stadt Beeskow sein. Der von der SPD gestellte Bürgermeister Frank Steffen steht dem kritisch gegenüber. Er sagte „Wir wollen hier keine zweite Asse werden“. Im Atommülllager Asse kam es zum Umweltskandal als bekannt wurde, dass der Austritt von radioaktivem Material droht.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
15. Juli 2010
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, kündigte nach einer Kabinettssitzung mit dem gesamten Bahnvorstand an, dass ab dem heutigen Donnerstag der gesamte Personennahverkehr mit Ökostrom versorgt werde. Damit ist das Saarland das erste Bundesland, in dem der Personennahverkehr ausschließlich mit Ökostrom betrieben wird. Durch den Einsatz von Ökostrom verringert sich der Ausstoß von Treibhausgasen um 13.000 Tonnen.
Ökostrom wird weiter forciert
Mit der Ökostrom-Versorgung des saarländischen Personennahverkehrs wurde das Tochterunternehmen DB Energie GmbH betraut. Der grüne Strom wird in deutschen Wasserkraftwerken produziert. Auch zukünftig soll der Ökostrom eine große Rolle bei der Energieversorgung der Deutschen Bahn spielen. Bis zum Jahr 2020 soll der Ökostrom-Anteil auf 30 Prozent am Gesamtenergieverbrauch ansteigen. Dies erklärte Rüdiger Grube.
Für den Ausbau der Schnellverbindung Paris-Saarbrücken-Mannheim-Frankfurt, die Erneuerung von Streckenabschnitten und weiteren Instandhaltungen wird die Deutsche Bahn nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden bis zum Jahr 2014 etwa 370 Milliarden Euro investieren.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
14. Juli 2010
Nach Angaben der Atomaufsicht musste bereits am Montag das Atomkraftwerk Brokdorf seine Leistung um drei Prozent (50 Megawatt) kürzen. Der Grund für diese Maßnahme war die Überschreitung der für die Elbe kritischen Wassertemperatur um ein Grad Celsius. Dass Kraftwerke vom Netz genommen werden oder ihre Produktion kürzen müssen, kommt an besonders heißen Sommertagen gelegentlich vor.
Notfallpläne in der Schublade
Tanja Gönner (Umweltministerin, CDU) sagte über die Situation in Baden-Württemberg, „Die Lage ist angespannt, aber noch nicht dramatisch. Die Situation könnte sich aber schon in den nächsten Tagen weiter zuspitzen“. Die Kraftwerksbetreiber sind grundsätzlich verpflichtet ab einer Wassertemperatur von 28 °C die Kraftwerke abzuschalten. Bereits jetzt wurden an verschiedenen Messstellen Temperaturen von 25 °C gemessen. Die Abschaltung der Kraftwerke soll verhindern, dass die Temperaturen im Wasser durch den Zufluss von warmem Kühlwasser weiter ansteigen und zu Fischsterben führen.
In den vergangenen Jahren kam es des Öfteren zu Abschaltungen von Kraftwerken. Auf Grund dieser Erfahrungen wurden Notfallpläne entwickelt, die eine sichere Stromversorgung gewährleisten sollen. „Im Ernstfall kann auf dieser Grundlage schnell eine sachgerechte Abwägung zwischen ökologischen Belangen und sicherer Energieversorgung getroffen werden“, erklärte Gönner
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
13. Juli 2010
Stefan Mappus ()Ministerpräsident Baden-Württemberg) hält an der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke fest und fordert den raschen Kohle-Ausstieg. „Um das Klima zu schützen, brauchen wir zuallererst einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern“, erklärte er. Weiterhin sprach er sich für eine Verlängerung der Laufzeit um mindestens 15 Jahre und gegen die Einführung der Brennelemente-Steuer aus. Mit seinen Äußerungen facht er die Diskussionen zum Thema Atomausstieg, Laufzeitverlängerung und Brennelemente-Steuer erneut an.
Fossile Energieträger scharf kritisiert
In Baden-Württemberg werden vier Atomkraftwerke betrieben. Für große Windparks fehlt die Küste und der Betrieb von Kohlekraftwerken würde sich aus logistischen Gründen nicht lohnen. Dies scheint für Stefan Mappus Grund genug, um an der Atomkraft festzuhalten. Er übt starke, wenn auch nur teilweise berechtigte Kritik an Kohle- und Gaskraftwerken. Kohlekraftwerke verursachen einen enormen CO2-Ausstoß und auch der Kohleabbau schädigt die Natur, das isst weitreichend bewiesen. Doch eine übereilte Abschaltung wär sowohl volkswirtschaftlich als auch energiepolitisch nicht vertretbar. Im Gegensatz dazu arbeiten Gaskraftwerke sauber und flexibel. Sie sorgen für den Ausgleich bei der Stromproduktion, wenn weder Sonne noch Wind ausreichend zur Verfügung stehen um den Strombedarf zu decken.
Im Vergleich zu den Risiken der fossilen Energieträger geht von der Atomenergie eine weitaus größere Gefahr aus. Auch die Frage der Endlagerung von Atomabfällen ist bislang nicht geklärt.
„Die Idee, dass wir in fünf Jahren ausschließlich von Sonne und Wind und Wasser leben könnten bei der Energieversorgung, ist einfach falsch, und das weiß auch jeder, dass es naiv wäre, so eine Energiepolitik zu betreiben“, erklärte Guido Westerwelle (Außenminister) und schlägt sich damit auf die Seite von Stefan Mappus.
Bundesländer drohen mit Klagen
Das Gegengewicht stellen unter anderem die SPD, die Linke, die Grünen und Greenpeace dar. Sie warnen vor den Gefahren der Atomenergie und weisen auf die Konsequenzen hin, die sich bei einer Laufzeitverlängerung für die erneuerbaren Energien ergeben. Wird die Laufzeitverlängerung ohne die Beteiligung des Bundesrates beschlossen, drohen Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dies sagte unter anderem Renate Künast von den Grünen.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
12. Juli 2010
In der vergangenen Woche beschlossen sowohl Bundesrat als auch Bundestag die Kürzung der Förderung für Solaranlagen. Rückwirkend ab 01. Juli wird diese um 13 Prozent gekürzt und ab 01. Oktober um weitere 3 Prozent. Um den kleinen Solarstromproduzenten und der Solarbranche insgesamt entgegenzukommen, werden die Kürzungsmaßnahmen in zwei Schritten umgesetzt. Trotz der Kürzungen lohnt sich die Anschaffung von Solaranlagen weiterhin. Einen Ausgleich zur Kürzung schaffen die weiterhin fallenden Preise für die Solaranlagen.
Anschaffung genau durchdenken
Nils Boenigk (Agentur für Erneuerbare Energie) sagte, „Auch wenn die Rendite immer noch gut ist: Eine goldene Nase werden Sie sich nicht mehr verdienen“. Dennoch rät er jedem, der die Anschaffung einer Solaranlage plant, dies auch umzusetzen und die grundlegenden Überlegungen wie die Eignung des Daches, die täglichen Sonnenstunden, die Ausrichtung sowie Anzahl der Solarmodule nicht außer Acht zu lassen. Schon seit Anfang des Jahres ist eine steigende Nachfrage bei den Solaranlagen zu verzeichnen, der Experte rechnet mit gleichbleibender Nachfrage bis zum Oktober.
Nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten waren Solaranlagen für viele Hausbesitzer lukrativ, sondern auch wegen auch wegen der Förderung der Solaranlagen. Für das Einspeisen von Solarstrom erhalten die Solarstromproduzenten eine Vergütung die über dem üblichen Stromtarif liegt. Diese wird auf die Rechnung aller Stromkunden umgelegt, um die enormen Kosten für die Verbraucher zu senken, wurde die Förderung gekürzt.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »
9. Juli 2010
Nach den langwierigen Diskussionen um die Kürzung der Förderung für Solaranlagen steht es nun endlich fest. Die Kürzung wird ab 01. Juli dieses Jahrs in Kraft treten und für die ersten drei Monate etwas geringer ausfallen. Die Anhebung erfolgt zum 01. Oktober dieses Jahres. Der vom Vermittlungsausschuss vorgelegte Kompromiss wurde sowohl vom Bundesrat als auch vom Bundesrat akzeptiert.
Bundesrat konnte Kürzung nicht verhindern
Ursprünglich forderte Norbert Röttgen (Umweltminister) eine Kürzung bereits ab April, doch der Bundesrat stimmt dagegen und erwirkte den Einsatz eines Vermittlungsausschusses. Doch da es sich nicht um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handelt, konnte der Bundesrat die Entscheidungsfindung nur verzögern, aber die Gesetzesänderung nicht komplett verhindern. Die Förderung wird bei Dachanlagen ab Juli um 13 Prozent und ab Oktober um weitere 3 Prozent gekürzt. Bei den übrigen Solaranlagen verhält es sich ähnlich, nur das die Kürzung dort geringer ausfallen, aber auch wie bei den Dachanlagen gestaffelt werden.
Kategorie: Strom | 0 Kommentare »